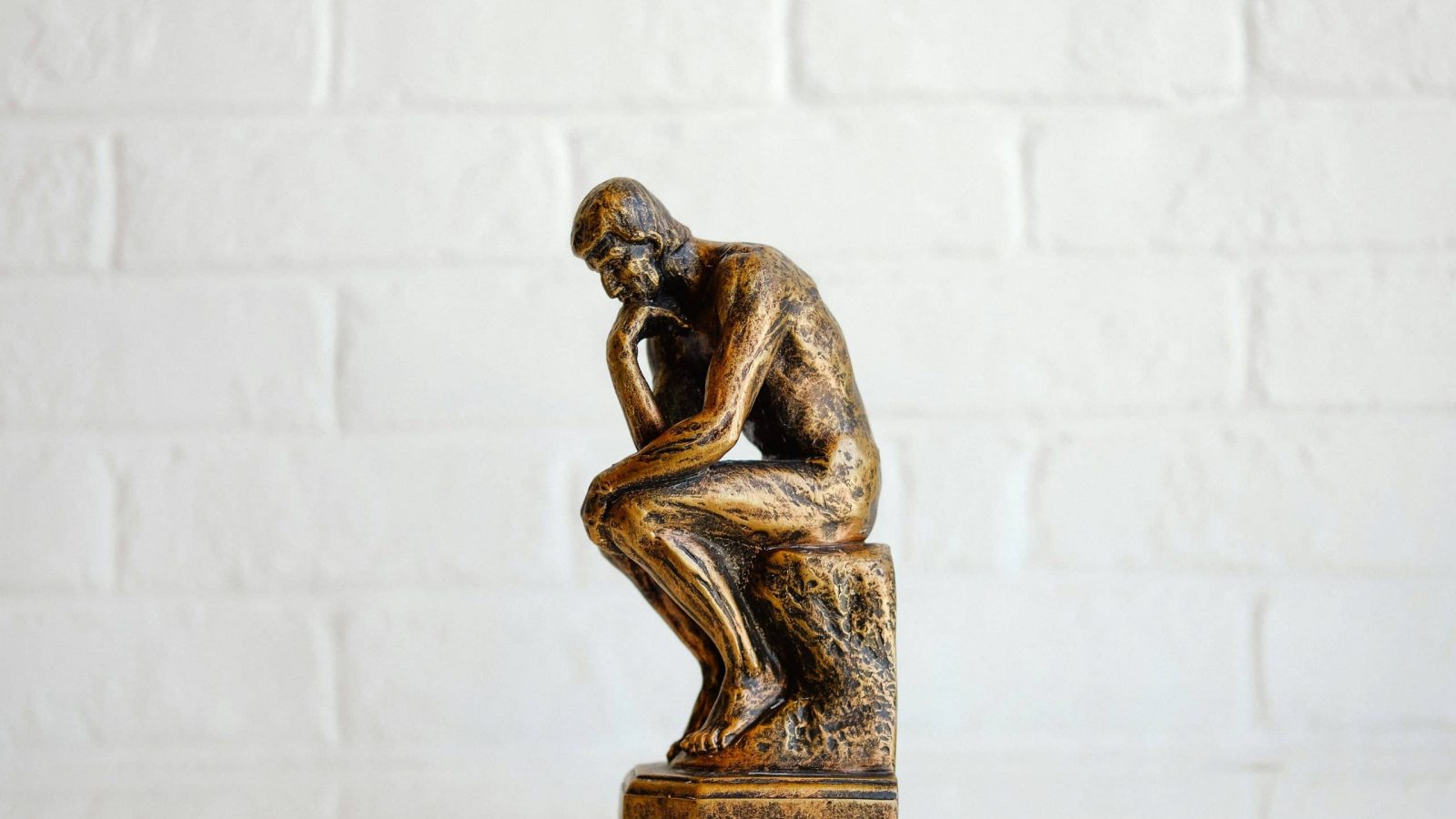Carsten Linnemann hat recht. Mal wieder. Und die Partei freut sich über den Klartext. Nur bleibt da immer dieses Gefühl: Recht haben und es aussprechen führt nicht zwingend zur Umsetzung. Und das hat Gründe. Aber beginnen wir von vorn.
Der aktuelle Vorschlag des CDU-Generalsekretärs, Verbeamtungen künftig auf echte hoheitsstaatliche Aufgaben zu beschränken, ist nicht nur richtig, sondern auch überfällig. Lehrer, Hochschulpersonal oder Berufsfeuerwehrleute künftig nicht mehr automatisch zu verbeamten, ist kein Angriff auf den öffentlichen Dienst, sondern eine realistische Antwort auf die wachsenden Pensionslasten. Wer die Zahlen kennt, weiß: So geht es nicht weiter.
Bemerkenswert ist: Linnemanns Vorstoß ist auch regierungskompatibel. Denn der schwarz-rote Koalitionsvertrag verpflichtet sich selbst, die Personalausgaben des Bundes um zehn Prozent zu senken und die Zahl der Stellen in der Verwaltung um acht Prozent zu reduzieren. Weniger Verbeamtung bedeutet langfristig: weniger Lasten, mehr Spielraum. Linnemann liefert also die Lösung zu einem Ziel, das die Regierung selbst formuliert hat. Trotzdem schlägt ihm – wieder einmal – Widerspruch entgegen. Auch in den eigenen Reihen ist man zurückhaltend bis kritisch. Zu hart, zu schnell, zu ehrlich.
Und genau hier liegt das Problem. Nicht in Linnemanns Vorschlag, sondern in der tiefen Verunsicherung der CDU selbst. Die Partei hat sich unter Friedrich Merz und Carsten Linnemann programmatisch neu aufgestellt. Das neue Grundsatzprogramm sollte Ordnung schaffen, Klarheit bringen, nach Jahren tagespolitischer Beliebigkeit wieder Richtung geben. Und tatsächlich: Für einen kurzen Moment war die Partei sortiert, strukturiert, selbstbewusst.
Doch dieser Moment währte nicht lange. Kaum war das neue Haus aufgeräumt, wehte der Wind der Tagespolitik hinein – in Form einer Großen Koalition mit kleiner SPD, die so niemand geplant hatte. Die CDU hatte keine Zeit, in ihrer neuen Rolle anzukommen. Kein Jahr, um die neuen Linien zu festigen. Kein innerer Dialog, bevor der äußere Druck wieder dominierte. Die Mitglieder wissen, wie Koalitionen funktionieren. Aber sie spüren, dass es zu früh war, und dass sich das, was programmatisch gesetzt war, nun wieder verwässert.
Der schmerzhafteste Bruch kam mit der Schuldenpolitik. Noch im Wahlkampf versprach die Union Haushaltsdisziplin. Wenige Monate später stimmte sie zusammen mit der SPD einer Verfassungsänderung zu, mit der fast eine halbe Billion Euro als Sondervermögen deklariert wurde. De facto an der Schuldenbremse vorbei. Für viele ein Bruch, der schwer wiegt.
Auch bei der Rente zeigt sich eine bemerkenswerte Dissonanz: Als Wirtschaftsministerin Katherina Reiche ein höheres Renteneintrittsalter ins Gespräch brachte, entsprach das exakt der Linie des CDU-Grundsatzprogramms. Und doch kam diesmal auch prominente Kritik aus den eigenen Reihen.
Das Ergebnis ist eine Partei, die mal Prinzipien betont, mal Kompromisse erklärt, aber zu selten klar macht, wann sie was tut und warum. Und so bleibt bei Wählerinnen und Wählern oft nur eines hängen: Verwirrung.
Was es jetzt braucht, ist mehr als richtige Vorschläge, die in der Öffentlichkeit zerkaut werden. Es braucht einen echten intellektuellen Prozess. Nicht nur nach innen, sondern nach außen. Die CDU darf sich nicht mit der Arbeit in Bundesfachausschüssen begnügen. Sie braucht ein Zentrum politischer Debatte, ein Konrad-Adenauer-Haus, das sich wie ein Thinktank versteht: offen, dialogbereit, mit gesellschaftlichem Anspruch. Grundsatzarbeit darf kein abgeschlossenes Projekt sein.
Denn wer sich auf Regierungsverantwortung vorbereitet, muss mehr leisten als Disziplin. Die CDU muss erklären, was geht und was (noch) nicht. Sie muss Erwartungen managen, ohne sie aufzugeben. Sie muss den Dialog mit Partei, Fachöffentlichkeit und Bevölkerung neu organisieren. Und sie muss aufhören, programmatische Klarheit als Widerspruch zur Regierungsfähigkeit zu behandeln.
Denn die Große Koalition mit der SPD ist nicht das Ziel. Sie ist der Preis der Umstände. Wer 2029 nicht nur irgendwie, sondern mit Überzeugung gewinnen will, muss jetzt damit anfangen, sich selbst ernst zu nehmen. Und der Öffentlichkeit zu zeigen: wir würden, wenn wir könnten. Und wir vergessen nicht, was wir wollten.