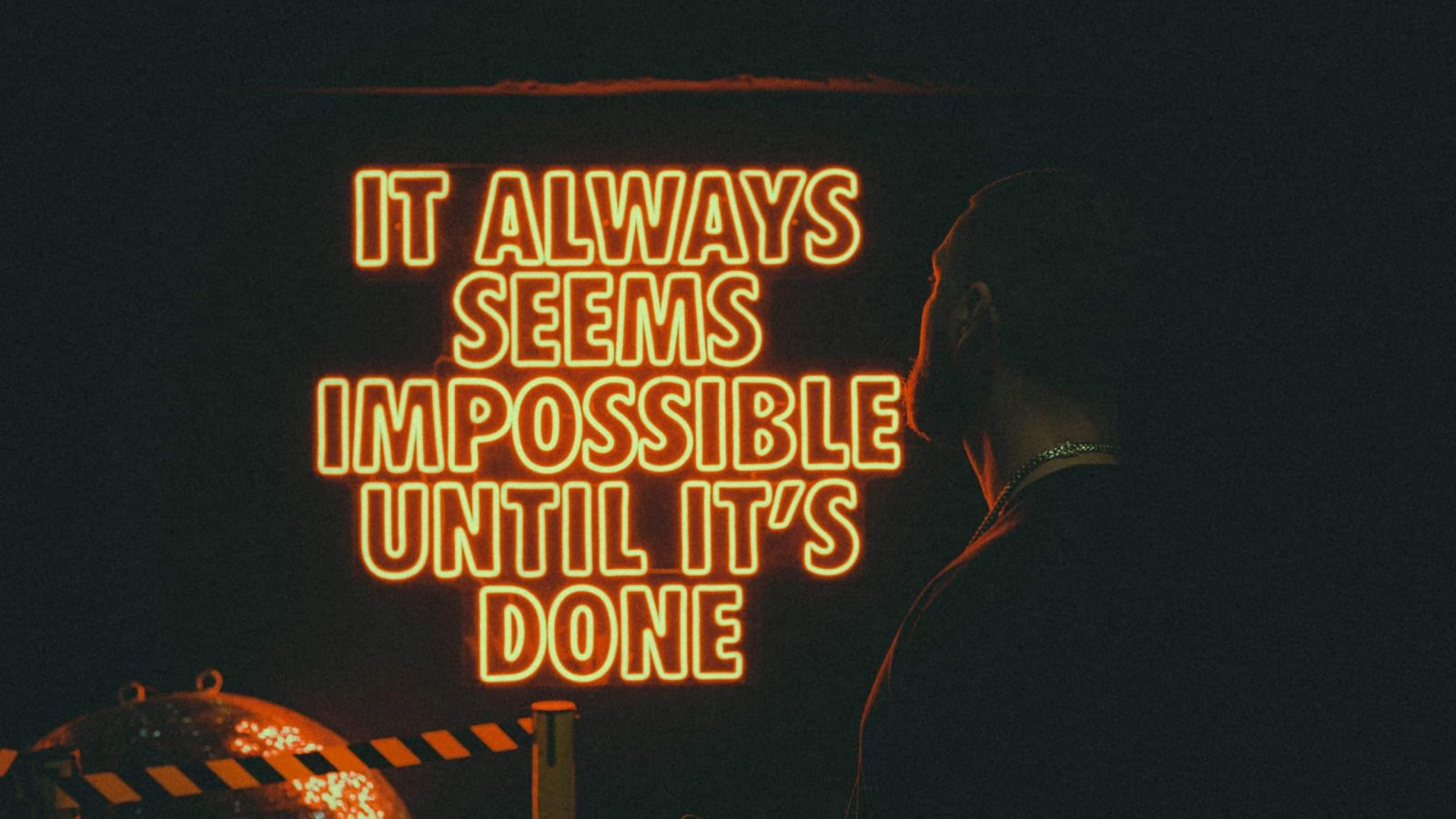Katherina Reiche, Bundeswirtschaftsministerin, hat gerade etwas getan, das in Berlin inzwischen Seltenheitswert hat: Sie hat die Realität angesprochen. Unser Sozialstaat fährt auf Verschleiß, die Demografie arbeitet gegen uns, und wenn wir so weitermachen, droht eine Kostenlawine bei Rente, Kranken- und Pflegeversicherung. Reiches Botschaft ist simpel: Wir müssen uns ehrlich machen.
Für Wirbel gesorgt hat sie mit dem klaren Satz: Es sei nicht tragbar, „dass wir nur zwei Drittel unseres Erwachsenenlebens arbeiten und ein Drittel in Rente verbringen“. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger lobte diesen Ausspruch als längst überfälliges „Rendezvous mit der Realität“. Die Fakten sprechen eine deutliche Sprache: Sozialversicherungsbeiträge könnten in zehn Jahren von rund 42 % auf fast 50 % steigen.
Dieser empfundene Tabubruch brachte zuallererst die SPD auf die Palme. Die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Dagmar Schmidt nannte den Vorschlag „fern der Lebensrealität“. Und Generalsekretär Tim Klüssendorf erklärte: „Eine Renteneintrittsaltersanhebung kommt für uns nicht in Frage “. Ein altbekanntes Ritual: Kopf in den Sand, Koalitionsvertrag hochhalten, Problem vertagen.
Doch genau in diesem Vertrag stehen die Kommissionen zur Renten-, Pflege- und Sozialstaatsreform . Sie sollen Vorschläge für Modernisierung und Entlastung liefern, flankiert von Expertengremien zu Kranken- und Pflegeversicherung. Die Regierung schafft damit Foren, in denen frei gedacht werden darf und vor allem kann, ohne dass eben jeder neue Gedanke sofort an „Steht nicht im Koalitionsvertrag“ zerschellt. Presse und Opposition spotteten bei der Präsentation des Koalitionsvertrages: „Alles nur Kommissionen!“ – als müsse Politik immer sofort alles wissen, können und zwischen Tür und Angel, nach vier Wochen Koalitionsverhandlung, entscheiden. Wohin sowas aber führt, beweist uns noch immer das katastrophal gescheiterte Bürgergeld. In Wahrheit können diese Kommissionen die Motoren für Reformen sein.
Deutschland kann das – die Geschichte beweist es. Die Hartz-Kommission war 2002 der Startschuss für die Agenda 2010: hart umkämpft, verhasst, am Ende Grundlage für ein Jahrzehnt wirtschaftlichen Aufschwungs. Die Rürup-Kommission empfahl die Rente mit 67 – damals unzumutbar, heute überlebenswichtig. Die vermeintlichen Vertagungen in Kommissionen von gestern sind mit genügend politischem Mut die Rettungsanker von heute.
Genau diesen Mut braucht es jetzt. Ministerin Reiche und Kanzler Merz signalisieren ihn, die SPD muss sich einen Ruck geben. Wer jede Diskussion mit „Da kann ja jeder kommen“ oder „Das haben wir schon immer so gemacht“ abwürgt, zementiert nicht nur die Rezession, sondern wird als Verwalter der blutleeren Bräsigkeit der vergangenen Jahre auch nur noch wenig eigene Zukunft haben.
Denn es geht um weit mehr als politische Manöver: Für die Demokratie ist es entscheidend, dass endlich wieder Ideen offen diskutiert werden. Pro und contra, Zustimmung oder Ablehnung – alles ist erlaubt, solange überhaupt gerungen wird. Diese Gesellschaft muss raus aus der ritualisierten Polit-Show, raus aus der Empörung um der Empörung willen, raus aus der endlosen Aneinanderreihung politischer Routine, die jede ernsthafte Debatte im Keim erstickt.
Kommissionen sind kein Stillstand, sie können der Startschuss für Bewegung sein. Sie öffnen Fenster in einem stickigen politischen Raum und geben der Demokratie die Chance, dass Argumente, Vorschläge und auch Widerspruch endlich wieder miteinander ringen können, bevor der häufig nur noch den Streit suchende Journalismus, ideologische Betonköpfe allerseiten oder schlicht der Alltag sie zerreibt.
Darum: Alle sollten Reicher werden. Nicht, weil alle einer Meinung sein müssen. Unser Land gewinnt, wenn wir mutig denken, ehrlich streiten und dann konsequent handeln. Allein dass Reiche die Debatte auf den Tisch gelegt hat, ist ein Gewinn für die Demokratie – unabhängig davon, ob man zustimmt oder widerspricht. Sie zwingt uns, Position zu beziehen, Argumente abzuwägen, für oder gegen etwas zu sein. Genau dieses lebendige Ringen, diese Auseinandersetzung statt betretenem Schweigen oder Abkanzeln, macht eine Demokratie stark. Am Ende stärkt genau das unser Gemeinwesen: die jungen Generationen, die nicht mit unbezahlbaren Lasten zurückbleiben dürfen; die Älteren, die auf einen verlässlichen Sozialstaat vertrauen; und die Demokratie selbst, die von offener Debatte aller Generationen um notwendige Entscheidungen lebt.
Raus aus der Lähmung, rein in die Kommissionen – und dann mit Mut voran. Wer sich an Debatten bereichert, gibt der Demokratie neuen Atem. Politik, die klug und mutig handelt, ein Land, das Ideen zulässt und daraus Reformen macht, wird am Ende wirklich reicher – im Kopf und im Portemonnaie.