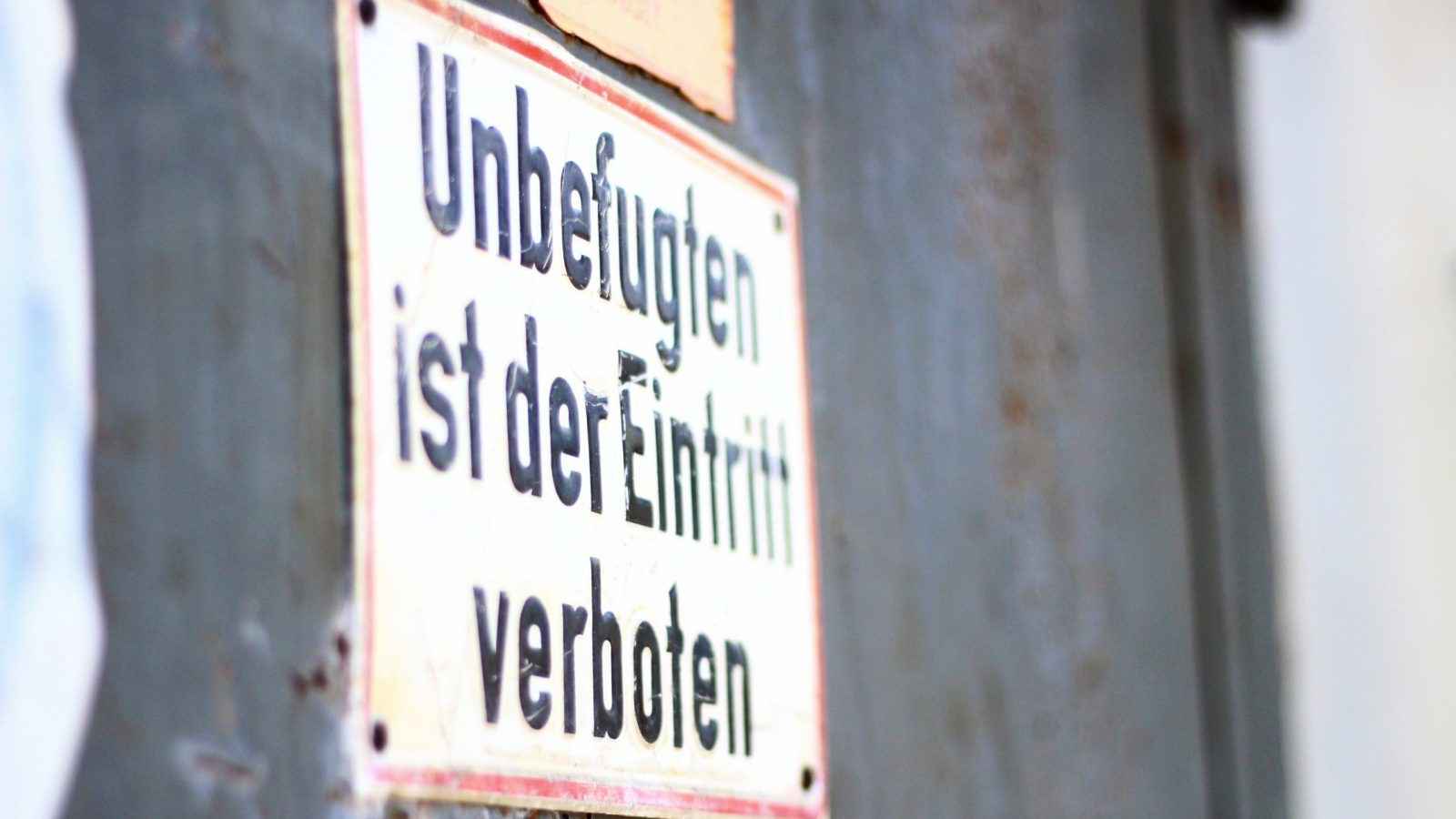Die Brandmauer war einmal ein Instrument der Selbstverteidigung der Demokratie selbst. Heute ist sie zu einem Werkzeug der Machtpolitik geworden. Was als Grenze gegen die Feinde der Demokratie gedacht war, funktioniert längst als Grenze innerhalb der Demokratie – als Mechanismus, mit dem sich eine Seite des demokratischen Spektrums das Monopol über die Bestimmung dessen sichert, was noch sagbar, denkbar, verhandelbar ist. Die Transformation ist subtil, aber folgenreich: Aus einem Schutzwall gegen das Extremistische wurde eine Demarkationslinie des Hegemonialen.
Das Problem liegt tiefer als in der bloßen Frage, wer mit wem koaliert oder spricht. Es liegt in der schleichenden Neudefinition dessen, was als demokratische Position überhaupt noch als legitim gilt. Und diese Neudefinition wird von einem politischen Milieu betrieben, das sich selbst als Hüter der Demokratie inszeniert, während es deren Grundprinzip – die Pluralität legitimer Positionen – systematisch untergräbt.
Die Mitte wird nicht mehr als Feld verstanden, in dem Verschiedenes konkurriert und sich arrangiert. Sie wird zur moralisch-politischen Kampfzone, in der Rot-Grün bestimmt, wo die demokratische Rechte enden muss. Eine politische Strömung, die längst keine Mehrheit mehr im Land hat, reklamiert für sich die Definitionsmacht über das Ganze. Sie tut dies nicht durch Argumente, sondern durch moralische Überwältigung.
Der Mechanismus dabei ist perfide. Jede auch nur im entferntesten als konservativ zu kategorisierende Position wird nicht mehr inhaltlich bestritten, sondern auf ihre moralische Reinheit überprüft: Jede Betonung nationaler Interessen gilt als Vorstufe zum Nationalismus. Jede Skepsis gegenüber Migration als verkappte Fremdenfeindlichkeit. Jede Kritik an Identitätspolitik als Angriff auf Minderheiten. Das ist kein Diskurs mehr, das ist Diskursterror. Es ist die Ersetzung politischer Auseinandersetzung durch moralische Verdächtigung.
Die grüne Moralisierungsmaschine
Besonders die Grünen haben diese Technik zur Perfektion gebracht. Was als Partei für Umwelt und Frieden begann, ist zu einer Gesinnungspolizei geworden, die ihre Weltanschauung nicht mehr als eine Position unter anderen begreift, sondern als moralische Grundnorm, der sich alle anderen zu unterwerfen haben. Der Klimaschutz wird nicht verhandelt, sondern verkündet. Die Migrationspolitik wird nicht diskutiert, sondern dekretiert. Die Genderfrage wird nicht erörtert, sondern durchgesetzt.
Wer widerspricht, wird nicht widerlegt, sondern aussortiert. Das Instrument ist die moralische Stigmatisierung: Man ist nicht anderer Meinung, man ist auf der falschen Seite der Geschichte. Man hat keine anderen Prioritäten, man hat die falschen Werte. Man argumentiert nicht anders, man argumentiert unanständig. Diese Form der Auseinandersetzung ist totalitär in ihrem Gestus, auch wenn sie sich demokratisch gibt. Sie kennt keine legitime Opposition mehr, nur noch Gesinnungsgenossen und Gegner der guten Sache.
Die SPD, einst Volkspartei mit Bodenhaftung in der Arbeiterschaft, hat sich diesem Regime unterworfen. Aus Angst, als rückständig zu gelten, hat sie ihre eigenen Traditionen verraten: den Respekt vor den Lebensrealitäten der einfachen Leute, die Skepsis gegenüber moralisierendem Überschwang, das Bewusstsein dafür, dass Politik Interessenausgleich ist, nicht Welterlösung. Was bleibt, ist eine sozialdemokratisierte Linke, die sich von ihrer eigenen Klientel entfremdet hat und nun im Fahrwasser grüner Deutungshoheit mitschwimmt.
Der Unwillen zur Anerkennung
Diese Verschiebung entspringt einem spezifischen Unwillen der politischen Linken: dem Unwillen, die Existenz einer legitimen demokratischen Rechten nicht nur zu tolerieren, sondern anzuerkennen. Was damit gemeint ist, geht über bloße Duldung hinaus. Es geht um die prinzipielle Anerkennung, dass konservative, wertbewahrende, ordnungsorientierte – oder vielleicht sogar nach allen Maßstäben als veraltet zu beschreibende – Positionen nicht Überreste einer überholten Vergangenheit sind, sondern konstitutive Pole eines pluralen Gemeinwesens.
Doch genau dazu ist die linksgrüne Meinungsführerschaft nicht in der Lage. Ihr Selbstverständnis beruht auf der Überzeugung, auf der richtigen Seite eines historischen Prozesses zu stehen. Wer sich diesem Prozess widersetzt, ist nicht Gegenüber, sondern Hindernis. Nicht Partner im demokratischen Gespräch, sondern Blockierer des Fortschritts. Diese geschichtsphilosophische Selbstgewissheit macht blind für die eigene Hybris – und taub für alles, was sich nicht in das eigene Narrativ fügt.
Die Verweigerung dieser Anerkennung hat Folgen. Denn wo die demokratische Rechte nicht als gleichberechtigte Position gilt, sondern als potenzielle Vorstufe zum Extremismus, verengt sich nicht nur der Diskurs. Es verengt sich der demokratische Möglichkeitsraum selbst. Statt verschiedene Positionen einzubinden, sollen sie diszipliniert werden. Man will nicht mehr das Andere integrieren, sondern das Eigene durchsetzen. Das rot-grüne Projekt ist nicht mehr die Gestaltung einer Gesellschaft durch Kompromiss, sondern ihre Umformung nach dem eigenen Bild. Die reflexhafte Moralisierung ist dabei nicht Ausdruck von Überzeugung, sondern von Panik.
Und sie ist Gift für die Demokratie. Denn Demokratie lebt nicht von der Eindeutigkeit der Antworten, sondern von der Offenheit der Fragen. Sie verlangt nicht Bekenntnisse, sondern Bereitschaft zum Gespräch. Sie braucht nicht Menschen, die auf der richtigen Seite stehen, sondern Menschen, die bereit sind, die andere Seite zumindest verstehen zu wollen.
Die Medien als Verstärker
Dieser Furor wäre nicht so wirkmächtig, fände er nicht seine Resonanz in den Medien. Was einmal die vierte Gewalt war, die Kontrollorgan und Korrektiv sein sollte, ist selbst zur Partei geworden. Nicht im parteipolitischen Sinn, aber im Sinn einer moralischen Positionierung, die sich nicht mehr als eine unter vielen begreift, sondern als Hüter der richtigen Haltung.
Die klassischen Medien springen den Erregungswellen nicht nur hinterher, sie produzieren sie. Das journalistische Ideal der Neutralität, der Distanz, der multiperspektivischen Betrachtung – es ist einer gefühlten Richtigkeit gewichen, die sich selbst nicht mehr hinterfragt.
Dieser Journalismus versteht sich nicht mehr als Beobachter, sondern als Erzieher. Die Berichterstattung wird zur Einordnung, die Einordnung zur Bewertung, die Bewertung zur moralischen Verdächtigung. Was nicht ins Narrativ passt, wird nicht berichtet oder so gerahmt, dass es wieder ins Narrativ passt.
Das hat Folgen. Denn wenn große Teile der Gesellschaft sich in den klassischen Medien nicht mehr wiederfinden, suchen sie sich andere. Die AfD findet in diesen Medien längst nicht mehr statt – jedenfalls nicht als politische Kraft mit Positionen, die man diskutieren müsste, sondern nur noch als Objekt der Empörung, als Menetekel, als Bedrohung. Man muss nicht fragen, warum die AfD ihre eigenen Medienalternativen geschaffen hat. Die Frage ist, warum die etablierten Medien ihr keine andere Wahl gelassen haben.
Und hier schließt sich ein verhängnisvoller Kreis: Denn diese Alternativen sind allzu oft Alternativen zur Realität. Was in den klassischen Medien als moralische Überwältigung erscheint, kehrt in den neuen Medien als Verschwörungsdenken wieder. Die Parallelöffentlichkeit, die entsteht, ist nicht nur eine Parallelberichterstattung, sondern eine Parallelwelt. Wer der einen nicht mehr traut, glaubt der anderen alles. Die mediale Spaltung verstärkt die gesellschaftliche.
Demokratie braucht eine gemeinsame Öffentlichkeit, einen gemeinsamen Raum der Auseinandersetzung, in dem Verschiedenes zur Sprache kommen kann. Wenn dieser Raum in moralisch gesicherte Zonen und ihre radikalen Gegenöffentlichkeiten zerfällt, verliert die Demokratie ihre Vermittlungsinstanz. Was bleibt, sind Echokammern, die einander nicht mehr erreichen.
Die Volkspartei als zivilisierende Kraft
Hier liegt die historische Bedeutung der Union. Sie war nie nur eine weitere Partei im parteienstaatlichen Gefüge. Sie war ein politisches Integrationsunternehmen: eine Volkspartei im emphatischen Sinn, die nicht ein Milieu repräsentierte, sondern ein Spektrum zivilisierte. Von den sozialpolitischen Traditionen Norbert Blüms bis zu den wertkonservativen Positionen Alfred Dreggers, von den liberalen Impulsen einer Rita Süssmuth bis zur machtpolitischen Klugheit Helmut Kohls – die CDU hielt Spannungen nicht nur aus, sie machte sie produktiv.
Das war mehr als Pragmatismus. Es war eine Form politischer Synthesis, die das Konservative mit dem Sozialen, das Christliche mit dem Liberalen, das Bewahrende mit dem Gestaltenden verband. Die Volkspartei funktionierte als Übersetzungsmaschine zwischen verschiedenen Lebensformen, Interessen und Weltbildern. Sie war der Ort, an dem das Bürgertum und die Arbeiterschaft, die Stadt und das Land, Katholiken und Protestanten, Wirtschaftsliberale und Sozialkonservative eine gemeinsame politische Sprache fanden. Und wo auch Ost und West einen gemeinsamen Spannungsbogen ausgehalten haben.
Diese Integrationsleistung war keine Selbstverständlichkeit. Sie beruhte auf der Fähigkeit, Ambivalenzen zu ertragen, Widersprüche nicht aufzulösen, sondern in Balance zu halten. Die Volkspartei war der institutionalisierte Ausdruck einer demokratischen Reife, die begriffen hatte: Eine komplexe Gesellschaft lässt sich nicht auf einen Nenner bringen. Sie braucht Orte, an denen das Unversöhnliche trotzdem verhandelt werden kann.
Doch diese Fähigkeit setzt voraus, dass die Union selbst definiert, was Mitte bedeutet. Wer die Mitte nicht selbst beschreibt, lässt sie anderen. Und wenn sie einseitig von links definiert wird, kann die Union ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen.
Hier zeigt sich die Dialektik der Brandmauer in ihrer ganzen Brutalität. Indem die demokratische Rechte verengt, marginalisiert und mit dem Verdacht belegt wird, sie sei bereits auf dem halben Weg zum Extremismus, produziert man genau das, was man zu verhindern vorgibt. Wer keinen Ort mehr findet in den etablierten Formen der Repräsentation, sucht sich andere. Wer sich nicht wiederfindet in denen, die für ihn sprechen sollen, wählt die, die seine Nicht-Repräsentation zum Programm erheben.
Die linksgrüne Antwort darauf ist bezeichnend: Statt die eigene Rolle zu reflektieren, wird der moralische Druck erhöht. Statt Repräsentation anzubieten, wird Umerziehung verlangt. Statt zu verstehen, wird belehrt. Diese Haltung ist nicht nur arrogant, sie ist selbstzerstörerisch. Denn sie treibt genau die Menschen von der Demokratie weg, die sie zurückgewinnen müsste – und treibt sie in die Arme einer Partei, die nicht Teil der Lösung ist, sondern Teil des Problems.
Ambiguität als demokratische Tugend
Demokratie ist nicht der Ort, an dem die eine Wahrheit siegt, sondern der Raum, in dem Verschiedenes koexistieren kann, ohne sich gegenseitig zu vernichten. Sie lebt nicht von der Klarheit der Lösungen, sondern von der Fähigkeit, mit der Unklarheit der Lage umzugehen. Sie verlangt nicht Eindeutigkeit, sondern die Größe, Mehrdeutigkeit als Normalzustand zu akzeptieren.
Das Sofortige und das Unbedingte sind die stillen Gegner dieser Demokratie. Sie versprechen Orientierung, wo Orientierung vielleicht nicht zu haben ist. Sie stilisieren jede Frage zur Grundsatzfrage und jede Position zum Bekenntnis. Diese Unbedingtheit bedroht die Demokratie von zwei Seiten – mit unterschiedlichen Mitteln und unterschiedlicher Intensität.
Von links kommt sie als moralischer Furor, der jeden Konservativen zum potenziellen Extremisten erklärt. SPD und Grüne moralisieren ihre Positionen und verengen dadurch den demokratischen Raum. Sie bleiben dabei – bei aller Kritik – demokratische Parteien, die die Pluralität der Gesellschaft prinzipiell akzeptieren.
Von rechts kommt etwas anderes, weitaus Gefährlicheres. Die AfD ist nicht einfach die spiegelbildliche Antwort auf den linken Furor. Sie bleibt die Verkörperung dessen, wogegen die Brandmauer einstmals errichtet wurde. Während die Linke moralisiert, ethnisiert die AfD die Politik. Während SPD und Grüne Positionen stigmatisieren, konstruiert die AfD eine völkische Ordnung, in der Zugehörigkeit nicht durch Verfassung, sondern durch Abstammung bestimmt wird.
Die AfD arbeitet nicht nur mit Feindbildern – sie arbeitet mit Entmenschlichung. Sie spricht von der „Umvolkung“, vom „großen Austausch“, von der Bedrohung durch das Fremde. Sie relativiert historische Verantwortung und instrumentalisiert sie zur Selbstviktimisierung. Sie fordert nicht nationale Souveränität, sondern einen ethnisch homogenen Volkskörper. Sie träumt von einer Homogenität, die es nie gab und nie geben kann. Sie setzt nicht auf Integration verschiedener Positionen, sondern auf Exklusion ganzer Bevölkerungsgruppen. Das ist nicht Konservatismus, das ist Rechtsextremismus.
Der Unterschied ist fundamental. Die einen verengen den demokratischen Raum moralisch und beschädigen ihn dadurch. Die anderen wollen ihn völkisch schließen und damit zerstören. Das ist der Unterschied zwischen einem Gift und einem tödlichen Gift. Beides schadet der Demokratie – aber nur eines will sie im Kern vernichten.
Doch so klar diese Asymmetrie ist, so fatal ist ihre Dialektik: Der moralische Furor von links und die völkische Radikalität der AfD nähren sich gegenseitig. Je mehr die Linke die demokratische Rechte verengt, desto mehr Raum schafft sie für die AfD. Je stärker die AfD wird, desto intensiver wird der moralische Druck von links. Ein Teufelskreis, in dem die Mitte zerrieben wird.
Der Mut zur Spannung
In dieser Situation kommt der CDU die entscheidende Rolle zu. Sie ist die einzige Kraft, die diesen Teufelskreis durchbrechen kann – indem sie die demokratische Rechte wieder zu einem legitimen, selbstverständlichen Teil des politischen Spektrums macht.
Gerade im Osten zeigt sich, wie wenig die Union das Problem verstanden hat. Man spricht von „weißen Flecken“, die es zu füllen gelte. Man will mehr Präsenz zeigen, mehr Bürgerbüros eröffnen. Als interessiere sich irgendjemand in der ostdeutschen Provinz für ein weiteres Parteibüro. Diese Formel ist weiße Salbe auf einer tiefen Wunde. Das Problem liegt nicht in mangelnder Sichtbarkeit, sondern in mangelnder Repräsentation. Es geht um die Bereitschaft, andere Lebenswirklichkeiten, andere Erfahrungen und andere Deutungsmuster als legitimen Teil des politischen Spektrums anzuerkennen – nicht als Abweichung von einem vorgegebenen Narrativ, sondern als konstitutiven Bestandteil des Ganzen. Wer sich nicht repräsentiert fühlt, wählt nicht einfach anders – er wählt dann gegen das System selbst.
Wenn die CDU an diesem Sonntag über ihre Zukunft nachdenkt, über den Umgang mit der AfD, über die Frage nach Koalitionen und Brandmauern, dann steht weit mehr auf dem Spiel als strategische Klugheit. Es geht um die grundsätzliche Frage, ob die Union den Mut hat, wieder Volkspartei zu sein – gegen den Druck von links, der ihr die Breite verbieten will, und gegen die Versuchung von rechts, die ihr eine falsche Alternative anbietet.
Das erfordert drei Dinge: Erstens muss die Union die demokratische Rechte besetzen, indem sie sie wieder in die Mitte integriert. Sie hat mit dem neuen Grundsatzprogramm begriffen, dass konservative Positionen zu Wirtschaft, Migration, innerer Sicherheit, Familie und nationaler Identität keine Konzessionen an den Zeitgeist sind, sondern Teil dessen, was ihre bürgerliche Identität ausmacht.
Zweitens muss die CDU aufhören, sich für ihre eigenen Positionen zu entschuldigen. Sie muss aufhören, jeden konservativen Impuls durch progressive Rhetorik abzufedern. Sie muss aufhören, in vorauseilendem Gehorsam die Definitionsmacht der Linken zu akzeptieren. Stattdessen muss sie selbstbewusst vertreten, was sie für richtig hält – ohne sich ständig versichern zu lassen, dass sie noch im erlaubten Rahmen der links-grünen Befindlichkeiten bleibt.
Drittens muss die CDU die Integrationskraft zurückgewinnen, die sie einst auszeichnete. Sie muss zeigen, dass Volkspartei sein nicht bedeutet, allen zu gefallen, sondern vielen eine Heimat zu bieten. Dass Breite nicht Beliebigkeit ist, sondern Stärke. Dass man Widersprüche aushalten kann, ohne den eigenen Kompass zu verlieren.
Die Rückeroberung der Mitte
Was auf dem Spiel steht, ist mehr als die Position einer Partei. Es geht um die Neuvermessung dessen, was demokratische Mitte bedeutet. Die Mitte ist kein Korridor zwischen links und rechts, den die einen verengen und die anderen als Pufferzone betrachten. Sie ist keine Restkategorie oder Leerstelle zwischen den politischen Lagern. Sie ist ein eigenständiger politischer Raum mit eigener Substanz, eigener Legitimität und eigener Bedeutung. Sie ist die Integration verschiedener Wahrheiten in eine tragfähige Politik. Sie ist der Ort, an dem das Soziale und das Marktwirtschaftliche, das Nationale und das Europäische, das Bewahrende und das Gestaltende nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern sich gegenseitig befruchten. Wo Widersprüche nicht aufgelöst werden müssen, weil sie die Realität abbilden.
Diese Mitte neu zu definieren bedeutet nicht, sie neu zu erfinden. Sie war immer da – in der Geschichte der Union, in ihrer Fähigkeit, Dregger und Blüm unter einem Dach zu halten. Was neu sein muss, ist der Mut, diese Breite nicht nur intern zu dulden, sondern extern zu beanspruchen. Als Gegenentwurf zu einer Politik, die nur noch Bekenntnisse kennt.
Denn die eigentliche Alternative zur Verengung ist nicht die Verschiebung nach rechts, sondern die Erweiterung nach innen. Eine CDU, die nicht mehr fragt: „Wie weit dürfen wir gehen?“, sondern: „Wie viel Verschiedenheit können wir produktiv machen?“ Die nicht mehr defensiv erklärt, warum sie nicht die AfD ist, sondern offensiv zeigt, was die demokratische Rechte als Teil einer breiteren Mitte sein kann. Die nicht mehr reagiert auf Druck von außen, sondern aus eigener Überzeugung agiert.
Wenn die Union diese breitere Mitte zurückerobert – nicht als Kompromisslinie, sondern als eigenständigen politischen Pol –, dann verändert sich das gesamte politische Koordinatensystem. Dann ist die demokratische Rechte keine Bedrohung mehr, sondern eine Selbstverständlichkeit. Dann ist die Volkspartei kein Relikt, sondern wieder das belebende Moment der deutschen Demokratie.
Die Frage, die sich an diesem Sonntag stellt, richtet sich nicht nur an die Union: „Haben wir noch die Kraft, diese breite Mitte zu sein?“ Sie richtet sich auch an SPD und Grüne: „Sind wir bereit, unseren Anspruch auf die Definitionsmacht über die Mitte aufzugeben?“
Denn eine Linke, die der demokratischen Rechten den legitimen Platz verweigert, produziert die Radikalisierung, die sie bekämpfen muss. Die Brandmauer muss dort stehen, wo sie hingehört. Zwischen Demokraten und Antidemokraten. Nicht zwischen verschiedenen demokratischen Lagern. Der Diskurs muss sich ändern – von „Darf die CDU das?“ zu „Wie ermöglichen wir wieder einen demokratischen Raum, in dem alle legitimen Positionen Platz haben?“
Die Antwort entscheidet darüber, ob es in dieser Republik noch einen Ort gibt, an dem Politik umfassend stattfinden kann – einen Ort, der weder von moralischem Furor noch von völkischem Ressentiment beherrscht wird. Statt einer Demokratie, die zwischen denen erstickt, die nur ihre eigene Wahrheit dulden, und denen, die jede Wahrheit leugnen.
Diese Mitte wieder zu öffnen ist die Aufgabe. Nicht als Kompromiss, sondern als Kampfansage. An die Verengung von links. An die Vereinnahmung von rechts. An alle, die glauben, Demokratie sei nur die Durchsetzung ihrer Position statt des Aushaltens des Anderen. Denn eine Republik, die ihre Fähigkeit zur Mitte aufgibt, gibt sich selbst auf.